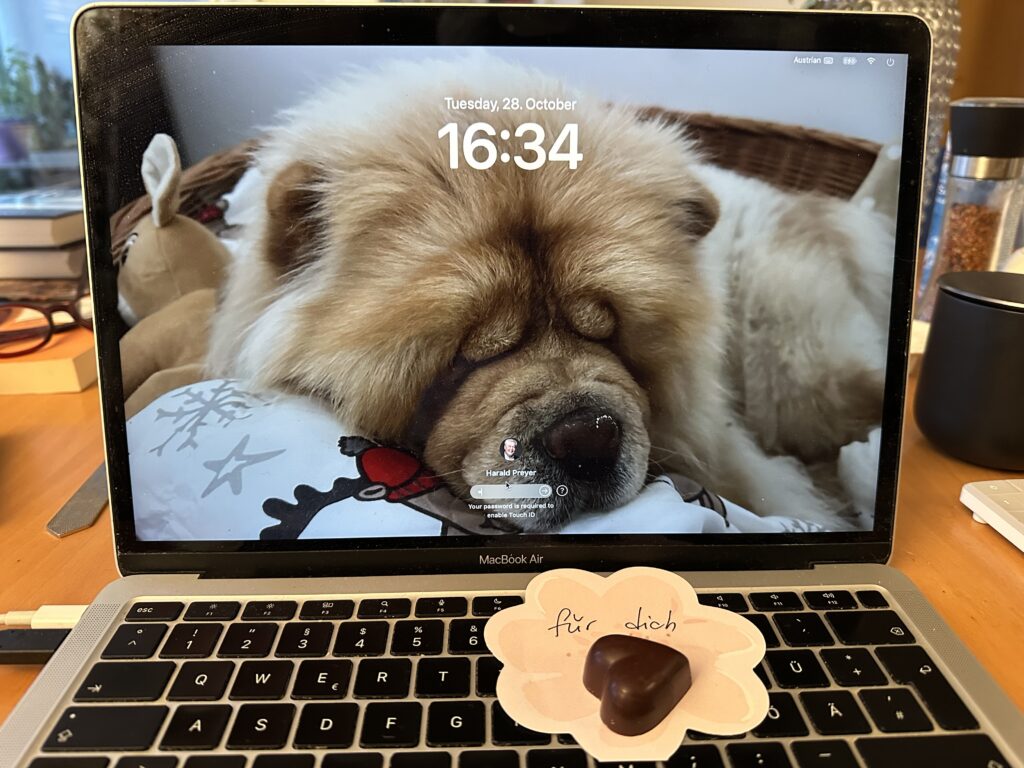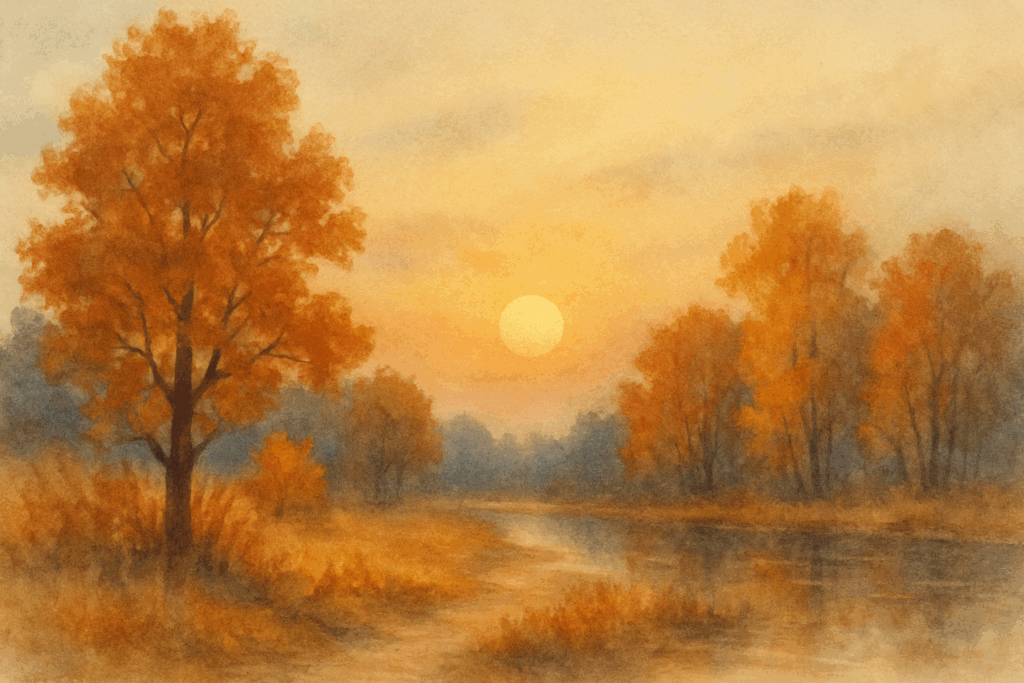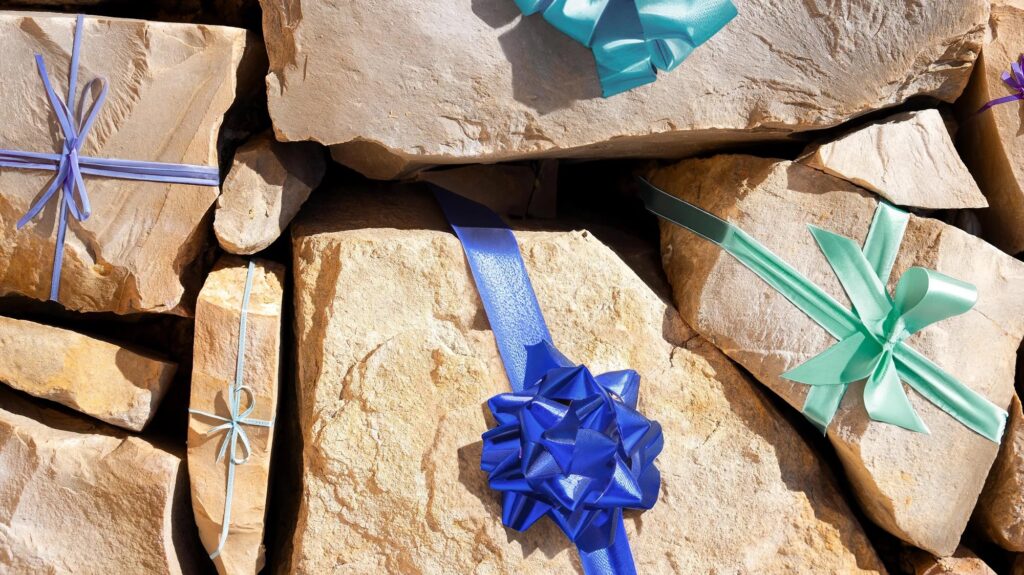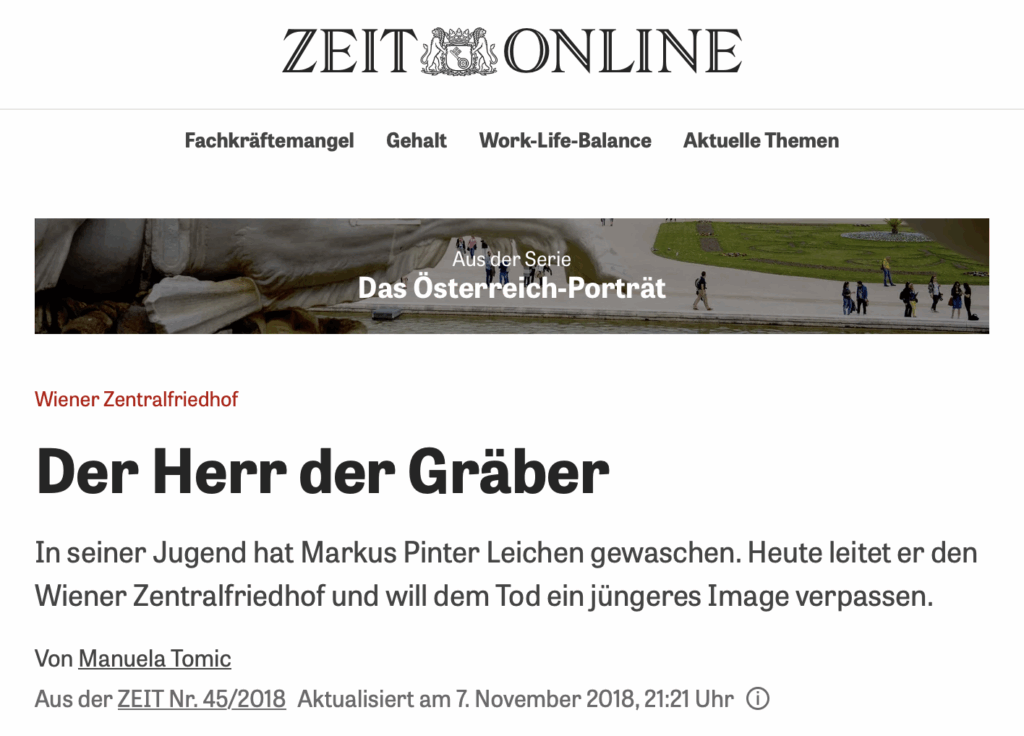Impuls von P. Johannes Paul Abrahamowicz, OSB bei den 2. Wiener Ganserlessen-Dialoge am 6. November 2024.
Wir sind alle berufen – zur Liebe, zum Fest des Lebens
Das Thema vom letzten Mal war – und es ist gut angekommen – Himmel, Fegefeuer, Hölle. Fast hätten wir es heute wieder nehmen können, weil so viele andere da sind. Heute aber geht es um die Frage: Wie ist das überhaupt mit dem Schicksal, mit der Vorherbestimmung? Gibt es so etwas?
Damit ist nicht gemeint, dass eine schwarze Katze von rechts oder Scherben Glück bringen. Nein – gemeint ist der große Lebensweg. Und da taucht immer wieder die Frage auf: Gibt es eine Vorherbestimmung oder nicht?
Ich möchte ganz klar sagen: Ja, es gibt sie. Und zwar eine sehr positive.
Jesus erzählt ein wunderbares Gleichnis – das Gleichnis vom Hochzeitsmahl.
Ein Mann lädt zur Hochzeit ein, lässt alles vorbereiten und schickt dann seine Diener zu den Eingeladenen: „Kommt, es ist alles bereit!“ Aber sie kommen nicht. Manche behandeln die Boten sogar schlecht.
Da lässt der Hausherr schließlich alle einladen, die er irgendwo findet – auf den Straßenecken, einfach alle. Und der Hochzeitssaal füllt sich – von Guten und Bösen, Reichen und Armen.
Dann kommt der Hausherr herein, schaut sich alle Gäste an – und plötzlich sieht er einen, der kein Hochzeitsgewand trägt.
Er fragt ihn: „Freund, wie konntest du so erscheinen?“
Der Mann ist sprachlos – und wird hinausgeworfen in die äußerste Finsternis.
Dann sagt Jesus den bekannten Satz:
„Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt.“
Ich habe diesen Satz lange nicht verstanden. Warum wird der arme Kerl hinausgeworfen? Vielleicht war er ja wirklich arm und hatte kein Gewand?
Erst viel später habe ich die Erklärung gefunden – auch dank der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen.
Denn in arabischen und orientalischen Ländern ist es bis heute üblich, dass man mit der Einladung zur Hochzeit auch das Hochzeitsgewand bekommt – entweder bezahlt oder symbolisch zur Verfügung gestellt.
Wenn also jemand ohne dieses Gewand erscheint, heißt das: Er hat die Einladung nicht wirklich angenommen.
Er wollte das Fest – aber nicht die Beziehung.
Und das ist der Kern des Gleichnisses.
Alle sind eingeladen. Alle sind vorherbestimmt – zu einem glücklichen, festlichen Mahl.
Aber ob wir die Einladung annehmen, liegt an uns.
Unsere große Vorherbestimmung ist das ewige Glück, das Fest der Liebe, das Reich Gottes. Nicht das kleine Aberglauben-Schicksal – Spinnen, Scherben, Glücksbringer – sondern das große Ziel: die Liebe.
Das Hochzeitsgewand steht für die Bereitschaft, Liebe zu empfangen.
Und wer glaubt denn nicht an die Liebe – als höchste Instanz im Leben?
In dieser Liebe, die keine Bedingungen stellt, sind wir alle berufen.
Das ist unsere Vorherbestimmung.
Ich bin fest davon überzeugt: Wir alle sind bestimmt zum Glück, zum Leben in der Liebe Gottes – und das dürfen wir schon jetzt, in jeder Eucharistiefeier, vorauskosten.
Und solange sich das Ganserl heute seinem Schicksal hingibt, dürfen wir dankbar sein, dass unser Schicksal ein anderes ist – ein gutes, liebevolles Schicksal.
Guten Appetit – und später bei der Nachspeise können wir gern noch Fragen stellen.
Kurz-Summary
P. Johannes Paul Abrahamowicz OSB deutet das Gleichnis vom Hochzeitsmahl als Bild unserer positiven Vorherbestimmung: Jeder Mensch ist eingeladen zum Fest der Liebe Gottes. Das „Hochzeitsgewand“ steht für die innere Bereitschaft, diese Liebe anzunehmen. Nicht Zufall oder Aberglaube bestimmen unser Leben, sondern Gottes Einladung zum Glück – die wir nur annehmen müssen.