Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes.
Röm 8, 1–2
Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes.
Röm 8, 1–2
Wir stehen heute vor einem Stoppelfeld.
Das Leben, das uns so vertraut war, ist geerntet.
Wir sehen die Leere, die uns bleibt – und wir spüren den Schmerz der Vergänglichkeit.

Nicht nur das leere Feld zählt, sondern auch die vollen Scheunen und die stehen gebliebenen Pflanzen.
Alles, was gelebt wurde, alles Gute, jede Spur der Liebe – es ist nicht verloren. Es ist eingebracht in die Scheunen der Vergangenheit, und in Gottes Erinnerung ist es für immer aufgehoben.
Jesus selbst sagt:
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ (Joh 12,24)
So dürfen wir glauben: Der Tod ist nicht Ende, sondern Vollendung.
Das Stoppelfeld zeigt uns die Vergänglichkeit –
die vollen Scheunen zeigen uns die Ewigkeit.
Und darin liegt unser Trost:
Die Liebe bleibt.
Die Seele lebt.
Das Wiedersehen kommt.
In Gottes Zeit.
Ich bin dankbar, dass wir in Österreich im Frieden leben – so lange ich mich erinnern kann. Für meine Eltern war das nicht selbstverständlich. Sie haben mir erzählt, dass sie manchmal mitten in der Nacht in die Luftschutzbunker laufen mussten, wenn die Sirenen heulten. Sie haben noch Krieg erlebt, Zerstörung und den mühsamen Wiederaufbau. Für mich dagegen ist Frieden wie die Luft, die ich atme. Oft nehme ich sie kaum wahr.
Wenn ich die Worte des Propheten Michaja lese, merke ich: Schon vor fast 3000 Jahren haben Menschen genau das ersehnt, was wir so leicht vergessen – Sicherheit, Gerechtigkeit, ein Leben ohne Angst. Michaja schaut in eine dunkle Zeit voller Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Korruption. Und er sagt: „Eine Frau wird gebären. Und das Kind, das zur Welt kommt, wird der Friede sein.“
Die Kirche feiert am 8. September Mariä Geburt. In ihr sieht sie jene Frau, die Gott erwählt hat, um seinen Sohn in die Welt zu bringen. Maria erinnert uns: Frieden kommt nicht durch Macht oder Gewalt, sondern ganz klein – in der Zerbrechlichkeit eines Kindes.
Brauchen wir heute einen neuen Michaja? Vielleicht. Aber vielleicht reicht es auch, dass wir selbst ein Stück Michaja werden – indem wir nicht vergessen, wie kostbar Frieden ist, und indem wir ihn im Kleinen weitergeben: in unseren Familien, in unseren Worten, in unserem Verhalten.
So spricht der HERR: Du, Betlehem-Efrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen.
Darum gibt der HERR sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des HERRN, in der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes.
Sie werden in Sicherheit wohnen; denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede sein.
Die römische Liturgie kennt drei Geburtsfeste: die Geburt Jesu, die Geburt seines Vorläufers Johannes und die Geburt Marias. Der Ursprung des Festes Mariä Geburt liegt wahrscheinlich in der Weihe der Kirche St. Anna, der Mutter Marias, in der Nähe des Betesdateiches in Jerusalem. Man nahm an, hier habe das Geburtshaus Marias gestanden.
Die Ostkirche kannte schon im sechsten Jahrhundert dieses Fest, im Westen wurde es durch Papst Sergius I. (687–701) eingeführt. Er nennt es unter den vier Marienfesten, die in Rom gefeiert werden: „Begegnung“ (Mariä Lichtmess, heute: „Darstellung des Herrn“), „Verkündigung“, „Mariä Himmelfahrt“ und „Mariä Geburt“. Im 10./11. Jahrhundert breitete sich das Fest in der gesamten katholischen Kirche aus.
Der 8. September als Geburtstag Mariens bezeichnet kein historisches Datum. Er steht im Zusammenhang mit dem Datum ihrer Empfängnis, das entsprechend neun Monate vorher für den 8. Dezember festgesetzt wurde. Am Geburtstag Marias betet die Kirche: „Die Geburt des Erlösers aus Maria war für uns der Anfang des Heils; das Geburtsfest seiner allzeit jungfräulichen Mutter festige und mehre den Frieden auf Erden.“
Der Prophet Micha ist ein jüngerer Zeitgenosse der Propheten Amos und Hosea und des Jesaja. Wie sie tritt er gegen die Entsolidarisierung der Gesellschaft an, die sich im ausgehenden 8. Jahrhundert v. Chr. in der Verarmung breiter Kreise der Bevölkerung zeigt. Kleinbauern und Handwerker werden rücksichtslos zu staatlichen Frondienstleistungen herangezogen und durch Steuerpolitik und die damit verbundenen Kreditgeschäfte gezielt ruiniert, der Beamtenapparat ist zunehmend korrupt, reiche Grundbesitzer halten Wirtschaftskriminalität für ein Kavaliersdelikt. Micha war wohl selbst Großbauer, der in der Funktion eines Bürgermeisters öfter in die Hauptstadt kam. Durch den Luxus der Reichen und Regierenden ließ er sich nicht blenden, sondern behielt einen klaren Blick. Sein Name ist Programm. Unverkürzt lautet er „Mi-cha-ja“: „Wer ist wie Ja(hwe)?“. Im Matthäus-Evangelium wird die Geburt des Messias von Micha 5, 1–4a her gedeutet: Ein Hirt Israels in der Kraft des Herrn und im hohen Namen des Herrn wird auftreten, machtvoll, und doch kein Machthaber und kein Machtmensch. Er wird „der Friede sein“!
Quelle: Magnificat – Das Stundenbuch, September 2025
Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Joh 20,29

eine Phantasie von Harald Preyer am frühen Morgen des 3.7.2025
Fest des Heiligen Thomas
Impuls zum Evangelium
Haben wir Nachgeborenen die Chance, Jesus, den Auferstandenen, zu berühren, gerade so wie sein Freund Thomas? Die Wundmale des Getöteten mit eigenen Augen zu sehen? Mit den eigenen Fingerspitzen zu fühlen, dass es Jesus ist? Oder ist das ein Privileg, das mit Himmelfahrt ausklang? Das Johannes-Evangelium antwortet mit großer Klarheit. Nicht nur der zu spät gekommene Thomas findet seinen Wunsch über alle Maßen erfüllt, auch uns Nachgeborenen soll das große ganze Glück der Nähe zufallen. Glauben wir das? Leben wir auf dieses Glück zu? Leben wir aus diesem Glück? Lassen wir dieses Glück unser Leben umwerfen, unserem Leben aufhelfen? Wie es Maria von Magdala wagte, wie Simon Petrus, wie Thomas? Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat es so gesagt, und wahrscheinlich können wir es gar nicht oft genug hören: Unter Christenmenschen gibt es keine „Jünger zweiter Hand“.
Quelle: Magnificat – das Stundenbuch
Seit 1995 lese ich täglich Magnificat – Mein Stundenbuch. Das ist ein auf Dünndruckpapier gedrucktes Monatsheft mit rund 300 Seiten, das für jeden Tag des Monats die Legende des / der Tagesheiligen, das Morgengebet, die Texte der Eucharistiefeier und das Abendgebet beinhaltet. Der anschließende redaktionelle Teil beinhaltet Themen des Monats.
Gleich am Beginn wird das Titelbild ausführlich von Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps aus Rottenburg beschrieben. Er hat mir ausdrücklich gestattet, seinen Text hier zu verwenden. Diese Texte sind für mich eine Meditation für den jeweiligen Monat. Das heurige Juli-Bild befindet sich in der Österreichischen Nationalbibliothek.

Erschaffung der Welt, Bible Moralisée, Paris, um 1225, Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. Vindobonensis 1179, fol. 1v
Aus Gott geboren
Jede Bible Moralisée des 13. Jahrhunderts zeigt den Schöpfer der Welt sozusagen als Titelbild (Frontispiz) vor dem eigentlichen Text mit den Medaillons. Bevor die einzelnen Teile der Bibel interpretiert werden, soll als Voraussetzung deutlich gemacht werden, dass die Welt aus Gottes Händen kommt, dass sie durch seinen Willen erschaffen wurde und er ihr „Architekt“ und Planer ist.
Wort, durch den die Welt geschaffen wurde.
Insofern können wir hier durchaus ein Bild Christi erkennen, der in seiner Beteiligung am Schöpfungswerk gezeigt wird.
Der Schöpfungsakt
Christus hält eine Kugel oder Scheibe auf dem Schoß. Diese ist mit verschiedenen Farben und Formen als die nach dem biblischen Bericht entstehende Welt gezeigt. In der Mitte sind gelb-grüne vegetabile Formen zu sehen, die das entstehende Leben auf der Erde meinen. Sie sind noch umgeben vom Schwarz der Finsternis über der Urflut (vgl. Gen 1, 1). Auch diese Urflut ist, von einem weißen Saum getrennt, von außen zu sehen. Nach dem biblischen Weltbild ist es aber auch das „Wasser oberhalb des Gewölbes“ (= Himmel) (Gen 1, 7), wie man sich den Regen erklärte. Außen umgibt die gesamte Welt ein grüner Rand, an dem Christus sie hält und trägt.
Das Instrument, das Christus in der Hand hält, ist ein Zirkel. Mit dem Zirkel übertragen früher Architekten auf den Plänen die Maßeinheiten und legten Messpunkte fest. Christus wird hier also als Architekt der Welt gezeigt. Er plant und beugt. Er plant und bemisst die Schöpfung, er legt die Mitte der Welt fest und bestimmt die Abstände der Schöpfung.
Wer ist hier dargestellt?
Die bildbeherrschende Person ist hier im Sitzen dargestellt. Andere Fassungen der Bible Moralisée zeigen sie stehend. Hier sitzt sie auf einem Faldistor (liturgischer Klappstuhl) und ist mit rot-blauen Gewändern bekleidet, die ornamentale Verzierungen zeigen. Die Füße sind nackt und der nach rechts geneigte Kopf wird von einem goldenen Nimbus mit Kreuz umgeben. Damit ist klar, dass es sich hier um eine der drei göttlichen Personen handeln muss: Gott Vater, Sohn oder Heiliger Geist. Ein Blick in das Gesicht des Mannes, vom welligen dunklen Bart und von ebensolchen, langen Haaren gerahmt, legt uns die Überzeugung nahe, dass es sich hier um Christus, die zweite göttliche Person, handeln muss. Doch so einfach ist es nicht.
Die Bibel spricht in beiden Schöpfungsberichten (Gen 1, 1 – 2, 3 und Gen 2, 4–25) von „Elohim“ (Gott, eigentlich Plural) bzw. sie benutzt ab Gen 2, 4 auch den Gottesnamen „JHWH“. Damit ist klar, dass hier der Vater gemeint ist, er ist der Schöpfer, aus seinem Willen entsteht alles Geschaffene.
Da der Vater aber nicht konkret darstellbar ist, wurde er in der mittelalterlichen Kunst manchmal mit den Zügen Christi gezeigt. Bei Darstellungen der Marienkrönung sehen wir dann zum Beispiel zweimal Christus mit der Taube des Geistes dazwischen (vgl. St. Georg in Gelbersdorf, Altar im nördlichen Seitenschiff, 15. Jh.). Insofern kann eine Darstellung Christi durchaus den Vater und damit den Schöpfergott meinen. Biblische Grundlage dafür ist Kol 1, 15, wo Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes genannt wird.
Hier ist es aber anders: Als Christen haben wir einen eigenen Blick auf die Schöpfungsgeschichte. Wir sehen hier nicht nur Gottvater tätig, sondern auch der Sohn und der Geist haben Anteil am Schöpfungswerk. „Gottes Geist schwebte über dem Wasser“ heißt es in Gen 1, 2 und wir nennen den Heiligen Geist im Glaubensbekenntnis denjenigen, der lebendig macht.
Noch deutlicher ist die Beteiligung der zweiten göttlichen Person am Schöpfungswerk. Im schon erwähnten Kolosserhymnus heißt es über Christus: „Denn in ihm wurde alles erschaffen […] alles ist durch ihn und auf ihn erschaffen.“ (Kol 1, 16) Dies ist theologisch ja auch ganz einleuchtend: Christus ist das Wort, der Lógos (vgl. Joh 1, 1 f.) und „alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist“ (Joh 1, 3). Und der biblische Schöpfergott muss im Gegensatz zu den Göttern des Vorderen Orients nicht kämpfen, um die Welt zu erschaffen, sondern er spricht (vgl. Gen 1, 3.6 etc.). Für die christliche Theologie ist es deshalb Christus, das
Im Gegensatz zu anderen Darstellungen ist er hier sitzend gezeigt, mit der Schöpfung im Schoß. Natürlich ist das kein Zufall. Der Maler hat hier ausdrücken wollen, dass die Schöpfung nicht nur durch Gottes Hände gestaltet wurde, sondern dass sie aus Gott geboren ist. Die Welt ist keine Kopfgeburt und kein Hand-Werk, sie stammt aus der Mitte der Liebe Gottes. Sie steht in Beziehung zu ihrem Schöpfer, aber sie ist auch ein Werk der Beziehung Gottes in sich, der Liebe zwischen Vater, Sohn und Geist. Gerade deshalb ist die Beteiligung aller drei göttlichen Personen so wichtig.
Mandorla und Engel
Die Christusfigur wird von einem mehrfachen Rahmen in der Form eines ovalen Vierpasses umgeben. Ohne Zweifel ist hiermit die gotische Form der Mandorla gemeint, eine Art Ganzkörpernimbus, mit dem Christus herausgehoben wird und der seine göttliche Herrlichkeit unterstreicht. Dementsprechend ist sowohl innen als auch außen Blattgold aufgebracht, das mit Ornamenten ziseliert wurde.
Auffällig ist, dass in allen vier Ecken Engel gemalt wurden, die in seltsamen Verrenkungen mit ihren Flügeln, Füßen und Gewandzipfeln die Eckfelder möglichst gut ausfüllen. Alle halten mit beiden Händen die Mandorla und schauen zu Christus hinauf bzw. herunter.
Wir haben hier keine Maiestas Domini vor uns, dazu müssten die vier Engel durch die vier (apokalyptischen) Wesen (vgl. Ez 1, 5–10) ersetzt werden und als Thronassistenten einer Theophanie (Gotteserscheinung) fungieren. Hier bezeugen die Engel die himmlische Herrlichkeit des Herrn, der die Welt ins Sein ruft und sich somit ein irdisches Gegenüber schafft. Sie ist sein Werk, von ihm geplant und geschaffen, sie entspringt seinem Willen und seinem Können. Sie ist aus ihm geboren und somit der ideale Lebensraum für die Menschen als Ebenbild Gottes (vgl. Gen 1, 27). Sie werden das eigentliche Gegenüber Gottes sein, Produkt und Ziel seiner Liebe, und zu ihrer Erlösung wird Christus in dieser Welt als Mensch geboren werden.
Heinz Detlef Stäps
aus der Mitte Gottes kommt alles was ist
er ist die Mitte der Welt
wer sich finden will muss Gott
suchen
in der Mitte der eigenen Seele
Heinz Detlef Stäps
Quelle: Magnificat. Das Stundenbuch (Monatsausgabe Juli 2025), Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer, Online-Ausgabe, S. 10–16.
„Götter haben viele Gesichter, aber wahre Göttlichkeit hat kein Gesicht“, heißt es in einer taoistischen Meditation. Der Satz will trösten, will Vielfalt ehren – doch er lässt uns am Ende im Ungefähren zurück.
Jesus Christus sagt etwas anderes.
„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ (Joh 14,9)
Gott bleibt nicht im Nebel. Er tritt hervor – mit einem Gesicht, mit Augen, die weinen können, mit Händen, die berühren. Mit einem Herzen, das liebt bis ans Kreuz.
Die Weltreligionen kennen viele Bilder von Gott. Die Bibel aber kennt nicht nur Bilder, sondern Begegnung. Nicht nur ein Ahnen, sondern ein Antworten.
Jesus nennt Gott nicht „das Absolute“ oder „das Formlose“. Er nennt ihn Vater – und lädt auch uns ein, ihn so zu nennen:
„Abba!“ – Papa. (Mk 14,36)
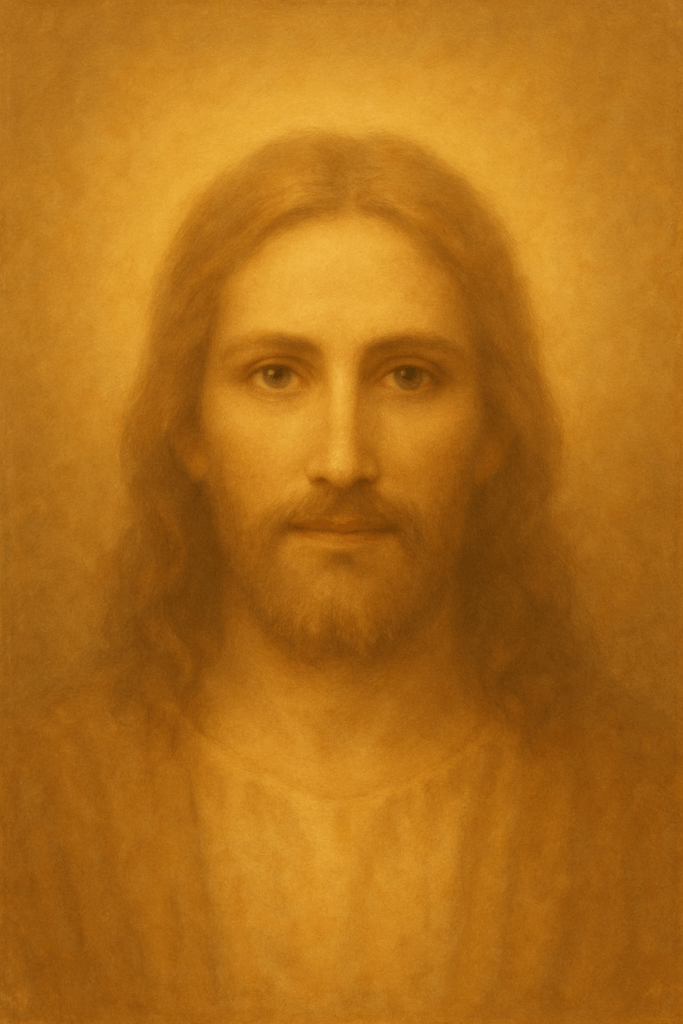
Wer trauert, sucht keine Philosophie. Wer leidet, will kein Prinzip.
Er oder sie sehnt sich nach Nähe. Nach einem Blick, einer Stimme, einer Umarmung.
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ (Joh 14,6)
Jesus zeigt uns den Weg – und er ist der Weg und die Liebe.
Nicht anonym. Nicht verschwommen. Sondern ganz Mensch. Ganz Gott.
Mit einem Gesicht.
Schon die Frage nach dem wozu? statt des warum? öffnet den Blick für Sinn – auch wenn sie das Dunkel nicht vollständig erhellt. Große Denkerinnen und Denker haben sich seit Jahrhunderten mit dieser existenziellen Frage beschäftigt. Ihre Antworten können auch heute noch trösten, stärken und den Horizont weiten.
Und Musik kann dabei ein liebevoller Begleiter sein.
Hiob (ca. 5. Jh. v. Chr.): Klage als Weg zu Gott
Im biblischen Buch Hiob wird das Leid nicht beschönigt. Hiob klagt – laut, bitter, ehrlich. Und gerade diese Klage wird zur Begegnung mit Gott. Am Ende steht kein logisches Warum, sondern eine stille, tragende Beziehung.
„Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; jetzt aber hat mein Auge dich geschaut.“ (Hiob 42,5)
Musik-Tipp: J. S. Bach – „Ich habe genug“, BWV 82
Jesus Christus (ca. 30 n. Chr.): Der Gott im Leid
Für Christinnen und Christen ist Jesus der Inbegriff göttlicher Solidarität. Er flieht das Leid nicht, sondern nimmt es auf sich – aus Liebe. Am Kreuz stirbt nicht nur ein Mensch, sondern Gott mit uns. Die Auferstehung aber zeigt: Das Leid hat nicht das letzte Wort.
„In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.“ (Joh 16,33)
Musik-Tipp: Pergolesi – Stabat Mater
Boethius (480–524): Das Leid als Schule der Weisheit
Der spätantike Philosoph Boethius schrieb im Gefängnis sein Werk Trost der Philosophie. Für ihn liegt im Unglück die Chance, sich von äußeren Sicherheiten zu lösen und sich dem Guten, Wahren und Göttlichen zuzuwenden. Leid wird so zur Einladung, sich an das zu erinnern, was wirklich zählt.
„Nichts ist elender als ein Mensch, der das verloren hat, was ihn zum Menschen macht.“
Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004): Wachsen durch Krisen
Die Sterbeforscherin betonte, dass das Leid ein Teil des Lebens ist – und ein Ort der Reifung. Ihre Phasenmodelle der Trauer helfen bis heute vielen Menschen, schrittweise wieder Vertrauen zu fassen.
„Die schönsten Menschen, die wir kennen, sind jene, die das Leid kennengelernt haben.“
Musik-Tipp: Mahler – Adagietto aus der 5. Symphonie
Viktor E. Frankl (1905–1997): Freiheit und Sinn trotz allem
Der Wiener Psychiater und KZ-Überlebende erkannte: Der Mensch ist auch im Leid frei – nicht in den Umständen, aber in seiner inneren Haltung. Wer dem Leben trotz allem einen Sinn abgewinnt, bleibt innerlich ungebrochen.
„Das Leben ist sinnvoll – immer, unter allen Umständen.“
Frankls Logotherapie lädt ein, Leid nicht nur zu ertragen, sondern zu verwandeln – in Mitgefühl, Verantwortung und Tiefe.
Musik-Tipp: Mendelssohn: 4. Sinfonie (»Italienische«)
Und wir?
Leid bleibt ein Geheimnis. Doch die Stimmen der Geschichte laden ein: nicht zu verzweifeln, sondern zu vertrauen. Und womöglich – ganz langsam – zu wachsen.
Nicht das Leid macht bitter – sondern das Alleinsein im Leid. Gott ist immer da. Wer gut begleitet wird, kann ihn spüren.
Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen.
Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes, und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Der Lebensatem des ewigen Gottes erquicke uns mit seinem Wehen und leite uns auf Wegen des Friedens.
Quelle: Abschluss des Morgengebetes in Magnificat – das Stundenbuch vom heutigen Pfingstsonntag 2025.
Pfingsten – der Moment, in dem die Liebe zu sprechen begann.
Es ist das Fest, an dem Gottes Geist die Kirche ins Leben rief – aber nicht für sich selbst.
Diese Liebe, von der die Oration spricht, wirkt in allen, die glauben.
Nicht nur in den Reihen der Getauften, sondern überall dort, wo Menschen ihr Herz öffnen für den Gott der Liebe.
Sein Geist ist wie ein stiller Wind, der Frieden bringt, wo Streit war.
Wie ein Lichtstrahl, der uns erkennen lässt:
Du bist nicht allein.
Die Liebe lebt. Und sie wirkt
Jesus von Nazareth, du bist als Mensch zu den Menschen gegangen. Wir rufen zu dir:
V: Sohn des Höchsten, A: erhöre unsere Bitten.
Für alle, die in der Verkündigung tätig sind;
– verleih ihnen die Gabe, den Menschen aus der Seele zu sprechen.
Für alle Glaubenden;
– lass sie durch die Art, wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen, deine Güte verkünden.
Für Menschen, die von schwerer Schuld bedrückt sind;
– sprich ihnen durch deine Seelsorger Vergebung zu und bahne ihnen einen Weg zurück in die Gemeinschaft.
Für unsere Verstorbenen;
– hole sie heim in die ewige Freude.
V: Sohn des Höchsten, A: erhöre unsere Bitten.
Quelle: Magnificat – das Stundenbuch
Abendgebet vom 1.6.2025
Weitere Fürbitten finden Sie unter den Stichworten „Bitten“ und „Fürbitten“ und zu den jeweiligen Themen.
Darum gilt den Jüngern damals und auch uns heute, nicht weiter zum Himmel zu schauen, sondern im Namen Jesu zu wirken, unsere Welt zu gestalten. Wir dürfen uns dabei der Zusage Jesu gewiss sein: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28, 20)
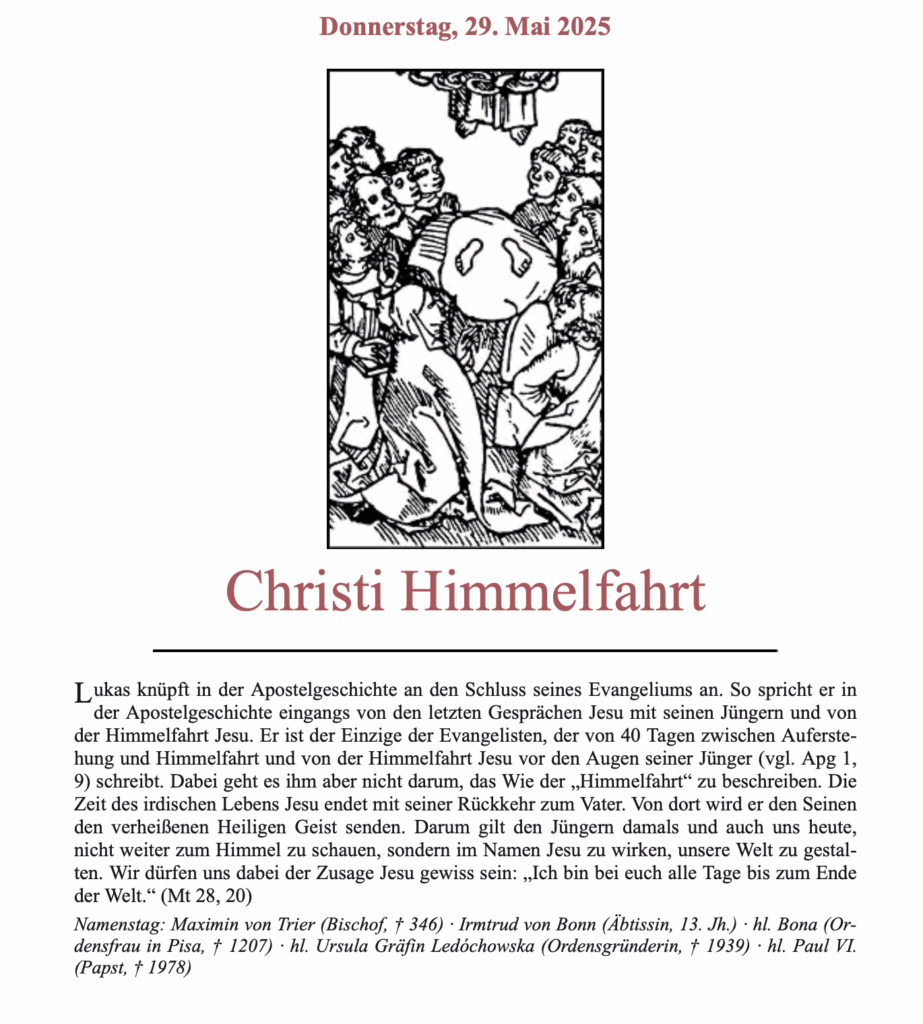
Quelle: Magnificat – das Stundenbuch