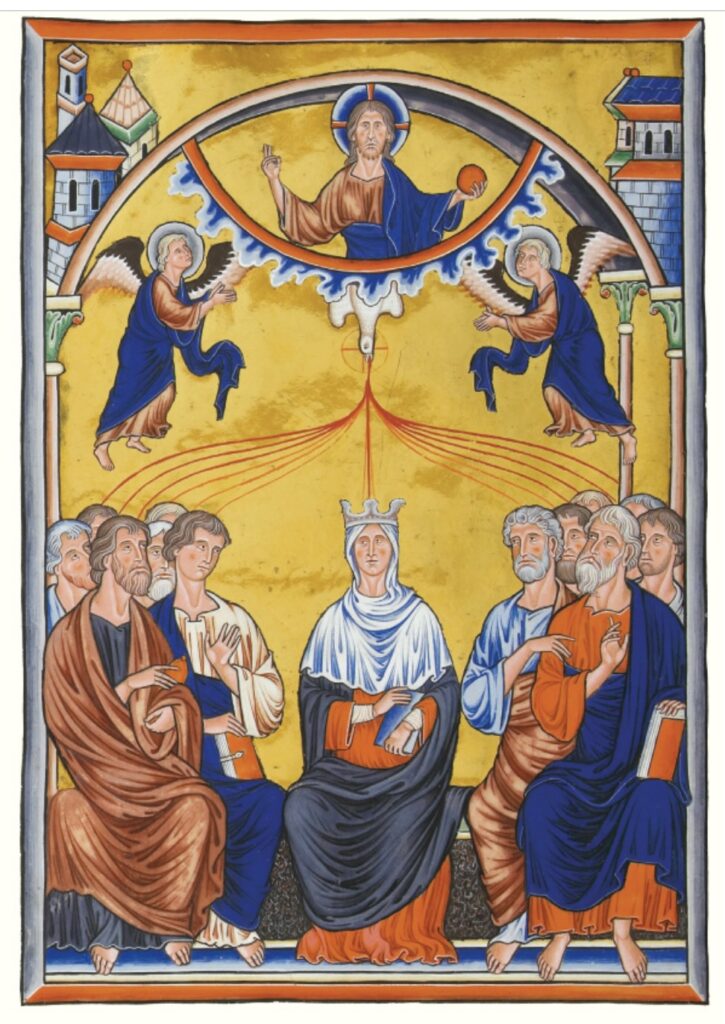1. Wiener Ganserlessen-Dialoge am 8. November 2023
Impuls von P. Johannes Paul Abrahamowicz OSB
„Der Himmel fängt auf der Erde an.“
Diesen Satz seines Vaters stellte P. Johannes Paul an den Beginn seines zwölfminütigen Impulses – und er zieht sich als roter Faden durch seine Gedanken zu Himmel, Hölle und Fegefeuer.
Wir alle wüssten, was Himmel ist: wo alles passt.
Doch der Mensch hat – anders als das Tier – einen freien Willen.
Darum kann er sich auch gegen etwas entscheiden, sogar gegen die Liebe selbst.
Weil Gott die Liebe ist, hat der Mensch – philosophisch gesehen – das Recht, dass es die Hölle gibt.
Was aber ist die Hölle?
Nicht ein Ort, an dem Gott nicht ist – denn Gott ist allgegenwärtig.
Sondern: Die Gegenwart Gottes ist für jene, die ihn ablehnen, unerträglich.
Darum ist das Feuer der Hölle in Wahrheit die Flamme der göttlichen Gegenwart – dieselbe Flamme, die in der Schrift als brennender Dornbusch, als Feuersäule in der Nacht oder als Licht der Osterkerze erscheint.
Das Fegefeuer wiederum ist kein Strafort, sondern eine Läuterung aus Liebe.
„Fegen“ heißt reinigen, und das Feuer steht wieder für Gottes liebende Nähe.
So wie Gold im Feuer geläutert wird, so wird auch der Mensch gereinigt – nicht vernichtet, sondern veredelt.
Ein Beispiel:
Wer plötzlich mit dem Rauchen aufhört, spürt Schmerzen des Abgewöhnens.
Ähnlich ist es, wenn man begreift, wie sehr Gott liebt – und erkennt, wo man selbst lieblos war.
Diese Reue ist schmerzhaft, aber heilend.
Das ist das Fegefeuer – die reinigende Liebe Gottes, die schon auf Erden beginnen kann.
Am Ende seines Impulses schloss P. Johannes Paul mit einem Lächeln:
„Die Gans hat fertig gebrutzelt – aber schon als Tote. Nachher reden wir weiter beim Essen.“
🕊️ Zusammenfassung
Der Mensch ist frei – nicht vorherbestimmt.
Diese Freiheit macht ihn fähig, sich für oder gegen die Liebe zu entscheiden.
Himmel, Hölle und Fegefeuer sind keine geografischen Orte, sondern Ausdruck dieser Beziehung zur göttlichen Liebe.
Himmel: gelebte Einheit mit Gott.
Hölle: dieselbe Gegenwart Gottes – aber unerträglich für jene, die sie ablehnen.
Fegefeuer: Läuterung durch Liebe.