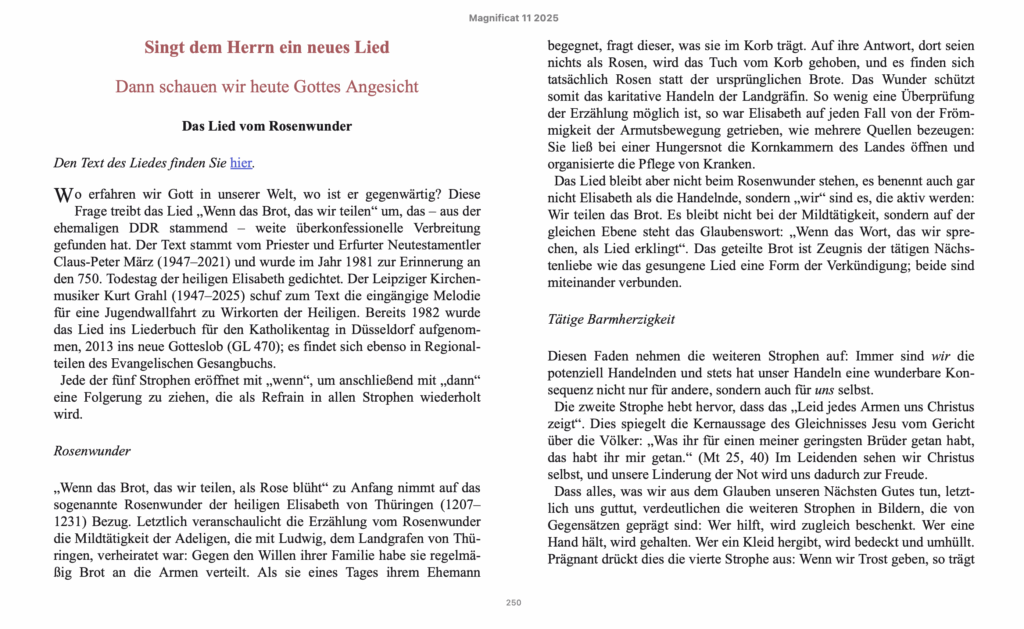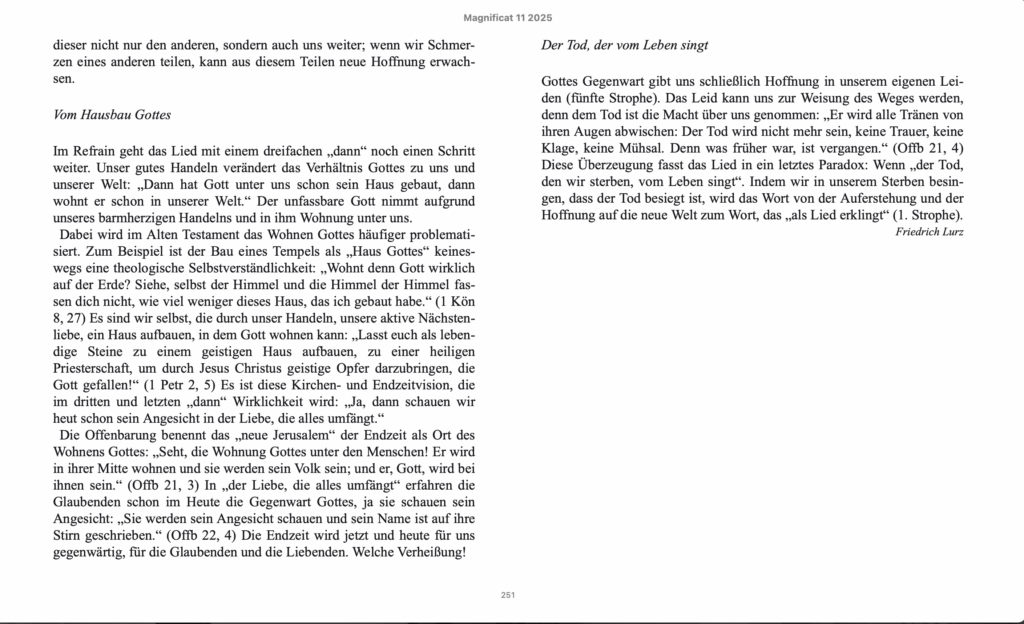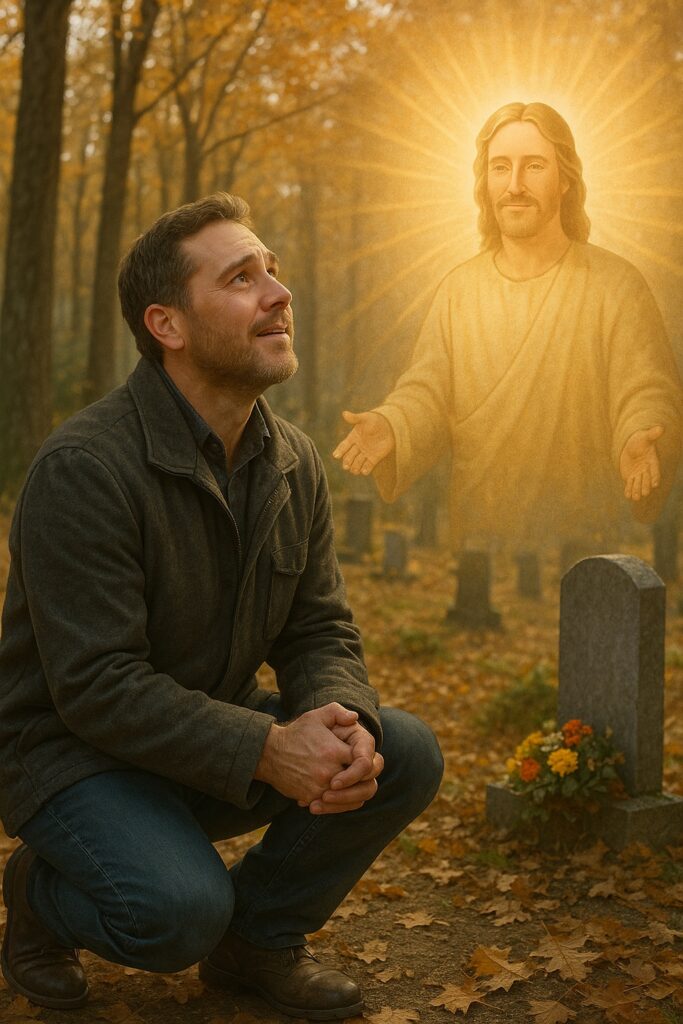Predigt von P. Johannes Paul Abrahamowicz OSB am 9.11.2025
Kirchweihfest
Am 9. November, ganz gleich, auf welchen Wochentag dieses Datum fällt, feiern wir das Kirchweihfest der Lateranbasilika.
Diese Kirche in Rom ist der eigentliche Bischofssitz des Papstes. Viele glauben, der Petersdom sei die Hauptkirche des Papstes – aber das stimmt nicht. Der Petersdom ist sozusagen die Hauskapelle des Papstes, sein eigentlicher Sitz, seine Kathedra, befindet sich in der Lateranbasilika. Auf ihrer Fassade steht in großen Buchstaben:
„Mater et Caput, Urbis et Orbis“ – Mutter und Haupt der Stadt und des Erdkreises.
Darum feiern wir Christen auf der ganzen Welt jedes Jahr am 9. November das Weihefest dieser Kirche, die uns an die Einheit der Kirche erinnert.
Wenn wir an Kirchweih denken, meinen wir natürlich nicht nur ein Gebäude aus Ziegeln. In der ersten Lesung haben wir vom Tempel gehört – einem Bau aus Steinen. Das Schöne an dieser Lesung ist das Bild, wie aus dem Tempel ein Strom von lebendigem Wasser fließt. An einer anderen Stelle im Alten Testament fließt ein solcher Strom nach Jerusalem hinein. Es gibt also beides – und beides sind schöne Bilder, die auf etwas Tieferes hinweisen.
Das lebendige Wasser bedeutet Frieden und Leben.
Wenn wir den Tempel als Bild für die Gemeinschaft der Glaubenden verstehen, heißt das: Aus jeder echten Gemeinschaft fließt Leben, fließt Frieden. So ähnlich haben wir das auch in der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief gehört.
Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, dass wir Tempel Gottes sind. Damit meint er nicht nur die Gemeinschaft insgesamt, sondern jeden Einzelnen. Gott wohnt in dir. Wir Katholiken kennen dieses Verständnis von der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten Sakrament.
Im Alten Testament war die Bundeslade Zeichen der Gegenwart Gottes, ebenso der Weihrauch, der an die Rauchsäule erinnert, die Israel durch die Wüste führte. Darum geht in unseren Prozessionen der Weihrauch vor dem Kreuz – als Symbol dieser Wolkensäule, die das Volk in das verheißene Land führte.
Als Salomo den Tempel einweihte, wurde er vom Rauch erfüllt – so stark, dass man nichts mehr sehen konnte. Diese Erfüllung mit der Gegenwart Gottes ist bis heute ein starkes Bild, das wir in der Liturgie bewahren. Zum Beispiel bei einem Begräbnis: Wenn der Priester den Sarg mit Weihrauch beweihräuchert, spricht er:
„Dein Leib war Gottes Tempel.“
Das bedeutet: Dein Leib war erfüllt von der Gegenwart Gottes – so wie einst der Tempel. Und so kann man weiterbeten:
„Der Herr erfülle dich jetzt mit seiner Gegenwart von ewiger Freude.“
So zeigt sich: Es geht im Glauben nicht um das Äußere, sondern um das Innere. Wenn wir Tempel Gottes sind, beherbergen wir Christus selbst. Jeder Einzelne und wir alle gemeinsam sind eine Gemeinschaft, aus der Frieden und Leben fließen.
Das geschieht durch die Liebe zu Gott und zum Nächsten.
Klingt leicht – ist aber nicht leicht. Niemand verlangt, dass wir darin perfekt sind, aber wir spüren: Es tut uns gut, wenn es uns gelingt. Darum tragen wir die Sehnsucht in uns, es immer wieder zu versuchen.
In diesen Tagen haben wir den heiligen Martin und die heilige Elisabeth als Vorbilder, Heilige der Nächstenliebe.
Ein Wort noch zum Ausdruck „Mutterkirche“: Dieses Bild wird auch heute in der Präfation, also kurz vor dem „Heilig“, erwähnt. Die Kirche ist Mutter, aber zugleich auch Braut. Da denken wir an Maria.
Die Glaubenskongregation in Rom hat vor kurzem verkündet, dass man nicht mehr sagen soll, Maria sei „Miterlöserin“ – Co-Redemptrix. Das hat einige durcheinandergebracht. Im deutschen Sprachraum brauchen wir uns darüber keine Sorgen zu machen, denn bei uns bedeutet Miterlöserin nicht, dass Maria auf gleicher Ebene mit Christus steht.
In den anderen Sprachen aber klingt das Wort „con“ – also con-Redemptrix – nach Gleichrangigkeit, und das musste klargestellt werden.
Ein Beispiel: Ein Priester, der mit einem anderen konzelebriert, ist ein Konzelebrant – also gleichrangig. Das ist bei Maria nicht so. Sie ist nicht gleichrangig, sondern Miterlöserin, weil sie Mutter und Mitwissende ist.
Sie wusste, was ihr Sohn erleiden würde, und sie hat zugestimmt.
In diesem Sinn ist sie Miterlöserin durch Mittragen und Mitlieben.
Darum: Keine Sorge über das vatikanische Dekret – in den anderen Sprachen ist es eine gute Klärung, dass Maria nicht identisch mit Jesus, sondern Teil seines Erlösungswerkes ist.
Wir sind als Gemeinschaft Kirche – Mutterkirche.
Die Mutter gebiert Kinder, deswegen gibt es Taufen.
Und das ist alles, was wir heute feiern:
Die Gemeinschaft der Gläubigen, aus der Friede ausströmt, weil sie Gott und den Nächsten lieben.
Amen.
✨ 2. Zusammenfassung
P. Johannes Paul Abrahamowicz OSB erklärt zum Weihetag der Lateranbasilika, dass diese Kirche der eigentliche Bischofssitz des Papstes ist und für alle Christen Symbol der Einheit der Kirche.
Er deutet die biblischen Lesungen als Hinweis darauf, dass nicht Steine, sondern Menschen der wahre Tempel Gottes sind – aus deren Herzen wie aus dem Tempel Salomos das „lebendige Wasser“ des Friedens und der Liebe fließt.
Der Weihrauch erinnert an die Gegenwart Gottes und an die Würde des menschlichen Leibes als Wohnort des Heiligen Geistes.
Als Christen sind wir berufen, Träger dieses Friedens zu sein, indem wir Gott und den Nächsten lieben.
Schließlich erläutert P. Johannes Paul die Entscheidung der Glaubenskongregation, Maria nicht mehr Co-Redemptrix zu nennen: Sie ist keine gleichrangige Erlöserin, sondern Miterlöserin durch Mittragen und Mitlieben.
So wird die Kirche als „Mutter“ verstanden, aus der neues Leben strömt – sichtbar in der Taufe und in jeder Gemeinschaft, die aus Liebe lebt.